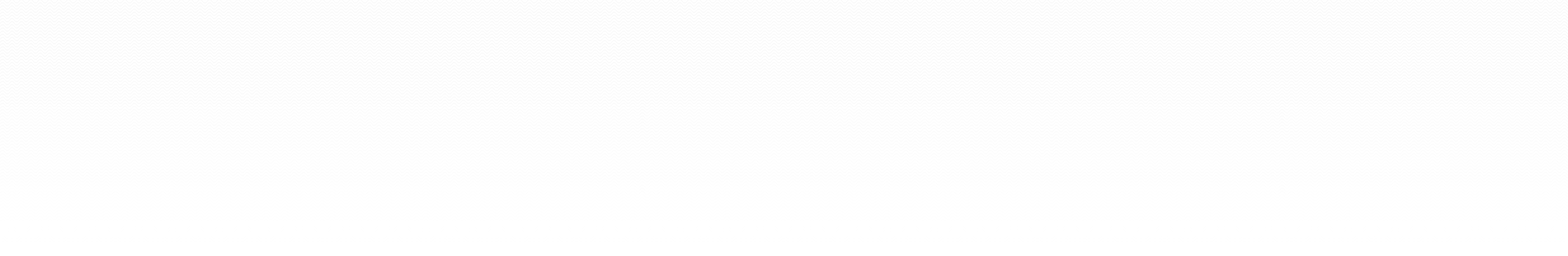Die Prometheus-Papiere.
Eine kleine Geschichte der Science Fiction.
© Frank Weinreich
Bedecke deinen Himmel,
Zeus, mit Wolkendunst!
Und übe, Knaben gleich, der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöh'n!
Mußt mir meine Erde doch lassen steh'n,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd, um dessen Glut Du mich beneidest.
(J. W. v. Goethe: Prometheus)
I, Was ist SF?
Ich möchte Ihnen hiermit einen
Überblick über die Geschichte der Science Fiction geben.
Der kann in einer Dreiviertelstunde Vortragszeit natürlich
nur sehr knapp ausfallen, wird aber für das, was ich
bezwecke, trotzdem ausreichend sein. Denn es kommt mir
nicht auf irgendwie geartete Vollständigkeit an, sondern es
geht mir darum, anhand einiger Ereignisse und Werke
aufzuzeigen, was Science Fiction ist und in welchem
Verhältnis sie zur realen Welt steht. Das geht auch anhand
einer ganz restriktiven Auswahl einiger Eckpunkte. Man muss
sich dabei nur klarmachen, dass dies Schlaglichter aus
einem riesigen Wust von Genreerzeugnissen in Buch, Film und
Computerspiel sind. Und Sie sollten mir nicht böse sein,
wenn Ihr Lieblingsbuch, Ihre Lieblingsserie nicht vorkommen
- ich erwähne auch viele Geschichten nicht, die mir sehr
gut gefallen.

Aufbrüche
Bevor die Übersicht beginnen
kann, ist es jedoch erforderlich, zu klären, was Science
Fiction überhaupt ist. Dabei tut sich ein ganz typisches
Problem auf: die Definition ist sehr schwer. Was allerdings
nicht bedeutet, dass es keine Definitionsversuche gäbe.
Ganz im Gegenteil. Clute und Nicholls beispielsweise gehen
auf 22 verschiedene Definitionen ein, und heben dabei
hervor, dass sie die aus einer viel größeren Menge
exemplarisch hervorgezogen haben. Und am Ende ihrer
Betrachtungen der Definitionsversuche kommen sie zu
folgendem Schluss „Es gibt eigentlich keinen Grund
anzunehmen, dass es jemals eine brauchbare Definition von
SF geben wird“ (Clute/Nicholls; Encyclopedia SF
314; meine Übers.).
Das möchte ich aber bestreiten. Jegliche Definition wird
natürlich immer in der Kritik stehen, und die Kritik wird
auch immer Punkte finden, wo die Definition Schwächen
aufweist. Aber das ist kein Grund, nicht doch eine zu
geben. Denn in der Praxis ist es doch so, dass es einen
Kernbereich von Inhalten gibt, die in der Regel zu Science
Fiction dazugehören und deren Werke so in den meisten
Fällen korrekt identifizieren. Und das sehen auch Clute und
Nicholls nicht viel anders, denn sie kommen zu dem Schluss,
dass es sehr wohl Kernbereiche von Genrewerken in SF oder
Fantasy gibt, die sich jeweils relativ problemlos und
konfliktfrei zuordnen lassen (vgl. 314).
Die Umrisse dieses Kernbereiches werden dabei von dem
Begriff selbst gesetzt: Science Fiction, also
Wissenschaftsfiktion. Dieser Begriff stammt von Hugo
Gernsback, der ihn im Jahre 1929 im Editorial der ersten
Ausgabe von Science Wonder Stories als Erster
benutzte. Es gibt übrigens Hardcore-Analysten der SF, die
das Genre deshalb auch erst 1929 beginnen lassen, doch dazu
gleich mehr.
Science Fiction sind also erfundene Geschichten, die
irgendetwas mit Wissenschaft zu tun haben. Nur reicht das
natürlich nicht, denn das Wichtigste fehlt dabei. Science
Fiction gehört in die Gruppe der Phantastik – Fiktionales
über Wissenschaft aber kann man auch schreiben, wenn man
eine erfundene Geschichte über Madame Curie oder Charles
Darwin brächte. Zu SF wird eine Wissenschaftsfiktion erst,
wenn die Geschichte von Unmöglichem handelt, von etwas,
dass es nach heutiger Erfahrung nicht gibt: Zeitreisen,
Teleportation, Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. In der
ersten systematischen literaturwissenschaftlichen
Betrachtung der SF aus dem Jahr 1947, Pilgrims Through
Space and Time, hebt der Autor James Osler Bailey denn
auch hervor: „Science Fiction ist die Erzählung von einer
imaginären Erfindung oder Entdeckung innerhalb der
Naturwissenschaften und von den sich daraus ergebenden
Abenteuern“ (Bailey, Pilgrims 10; meine Übers.).
Das ist nun eine sehr enge Definition, die einen Großteil
der Science Fiction der Nachkriegsjahre nicht erfasst. Man
denke nur an die gesamte postakopalyptische Literatur und
Filme, die von den Ereignissen nach einem globalen
Atomkrieg erzählen, wenn die Welt üblicherweise so kaputt
ist, dass nix mehr erfunden wird. Aber das Imaginäre und
der Wissenschaftscharakter sind in der Tat zentral. Nur
müssen es nicht Erfindungen und es müssen auch nicht allein
die Naturwissenschaften sein, was uns dann zu so einer
Umformulierung von Baileys Definition führen würde:
„Science Fiction ist die Erzählung von einer imaginären
Erfindung oder Entdeckung innerhalb der Wissenschaften und
von den sich daraus ergebenden Folgen.“
Eine der einflussreichsten Science Fiction-Reihen aller
Zeiten, der Foundation-Zyklus von Isaac Asimov,
dreht sich beispielsweise ganz um die
Geschichtswissenschaft. Überhaupt wurden die
Naturwissenschaften und ihre unmittelbaren Produkte wie
Strahlenwaffen und Raumschiffe ab den Sechziger Jahren
stark zurückgedrängt von SF, die über soziologische,
politische, psychologische Ideen spekulierte. Alles, was
die große Ursula K. Le Guin etwa an SF geschrieben hat,
stellt Anthropologie, Soziologie und Psychologie in die
Mitte und Raumschiffe werden nur noch benötigt, um
Schauplätze zu erreichen, die die Konstruktion von
Extremsituationen erlauben, um dann zu spekulieren, wie
Menschen sich in ihnen verhalten würden. Dann muss es sich
auch nicht unbedingt um eine Erfindung oder Entdeckung
handeln, sondern kann auch ganz einfach die Voraussetzung
bestimmter Umstände sein. Wichtig ist dabei nur, dass die
erzählten Umstände und Geschehnisse den Naturgesetzen nicht
widersprechen (Clute/Nicholls 313).
Das transformiert die Ausgangsdefinition von Bailey dann in
meine Fassung: Science Fiction sind phantastische
Geschichten, deren irreale Anteile dem wissenschaftlichen
Erkenntnisstand der Autorinnen und Autoren nicht
widersprechen. Das setzt auf Seite der Erzähler voraus,
dass Science Fiction von Autorinnen und Autoren verfasst
und umgesetzt werden, die über eine gewisse
wissenschaftliche Grundbildung verfügen. (Eine
ausführliche Erläuterung der Definition finden Sie hier.)
Science Fiction erzählt Geschichten vom
Noch-Nicht-Möglichen. Kommen in der Geschichte
beispielsweise Zauber-Drachen vor – der klassische
Märchen-Drache ist nach den Erkenntnissen der Biologie
unmöglich (ja, es gibt auch SF-‚Drachen’, etwa in Anne
McCaffreys Geschichten von Pern) – oder wird vom Zaubern
erzählt – das ist nach allem, was die Physik weiß,
unmöglich – dann ist das nicht Science Fiction.
Dies sind die entscheidenden Erkennungsmerkmale von Science
Fiction: SF ist Fiktion, SF erzählt von Unmöglichem, das
Unmögliche muss aber zumindest theoretisch, und sei es noch
so abwegig, möglich sein. Wichtig ist bei letzterem dann
noch der jeweilige Erkenntnisstand: Was den Naturgesetzen
entspricht oder widerspricht, ist zeitabhängig. Die heutige
Physik beispielsweise kann zeigen, dass Zeitreisen
theoretisch möglich sind. Aber nur, wenn die
zugrundeliegenden Modelle richtig sind. Gerade da ist aber
ständig vieles im Fluss, und sollte es eines Tages erwiesen
sein, dass die zugrundeliegenden Modelle das Zeitreisen
selbst in der Theorie unmöglich machen, so werden
neue Zeitreisegeschichten zu Fantasy.
Science Fiction erzählt Geschichten, die zumindest
theoretisch möglich sind. Das hat für die Analyse dessen,
was SF kann, ganz praktische Auswirkungen. Wenn nämlich
alles, was erzählt wird, tatsächlich irgendwie irgendwann
auch so geschehen könnte – etwa der Erstkontakt zu anderen
intelligenten Lebewesen –, dann spekuliert SF sehr handfest
darüber, was der Mensch tun wird, was er tun darf, und
welche Auswirkungen das hätte. Das Potenzial von SF ist
also ganz eminent politischer und psychologischer Natur.
(Während die Fantasy eher philosophisch ist, denn sie
fragt, wie Lebewesen reagieren, die keine andere Wahl haben
... als den Ring zu nehmen oder ihn zu vernichten,
beispielsweise.)
Damit erklärt sich auch der Titel meines Vortrages: die
Prometheus-Papiere. Prometheus war – ich hoffe ich
langweile Sie nicht zu sehr mit etwas, das Ihnen schon
bekannt ist – in der griechischen Mythologie ein Titan, der
den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen übergab.
Der Philosoph Platon machte aus diesem Mythos ein Gleichnis
darüber, wie der Mensch die Kultur errang und sein
Schicksal selbst in die Hand nahm (Protagoras
320c-322a). Vorher kreuchten und fleuchten die Menschen wie
die Tiere über das Angesicht der Erde; nun hatten sie durch
das prometheische Feuer – durch die kulturellen
Errungenschaften wie Städtebau, Landwirtschaft,
Metallbearbeitung usw. – die Freiheit gewonnen, damit aber
auch zugleich ein zweischneidiges Schwert in die Hand
genommen. Denn die Figur des Prometheus ist eine Metapher
für die Technik und Technik kann ebenso gut helfen wie
zerstören. Und das ist genau das, wovon Science Fiction
erzählt – sie spekuliert darüber, was passiert, wenn der
Mensch sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. In ihr gibt
es keine übernatürlichen Kräfte oder Götter, zu denen der
Mensch sich verhalten muss. Dadurch dass diese
übermenschlichen Kräfte wegfallen, behält der Mensch alle
Verantwortung und die SF-Autoren konzentrieren sich ganz
auf seine Erfindungen, Unternehmungen und Handlungen und
berichten von deren Triumph oder Scheitern. Überspitzt kann
man sagen, dass es in der Fantasy darum was wir glauben
sollen oder können. SF hingegen beschäftigt sich damit, was
wir tun können oder sollen. Das erste ist eine Reaktion;
wir stellen uns den unabänderlichen Dingen, wie sie sich
uns im Kosmos darstellen. Das zweite, das, was SF
vordringlich beschreibt, ist eine Frage der Aktion; es
stellen sich uns bestimmte Optionen dar und wir müssen
entscheiden, ob wir sie nutzen oder auslassen.

Tun oder lassen?
Bei dieser Überspitzung darf
man nun nicht vergessen, dass es reinrassige Genrewerke in
Buch und Film nur selten gibt. Meist vermischen sich
verschiedene Inhalte und es ist eine diskussionswürdige
Entscheidungsfrage, welche Bestandteile überwiegen und
wohin also ein bestimmtes Buch, ein bestimmter Film
gehören. Ein Paradebeispiel ist Star Wars. Die
meisten Fans und Kenner der Phantastik zählen Star
Wars zur Fantasy, denn die Geschichte handelt
zuallererst davon, auf welche Seite der übernatürlichen
Macht man sich stellt, dunkel oder hell. Trotzdem begegnet
einem Star Wars auch immer wieder als angebliche
Science Fiction – achten Sie nur darauf, wie es bei der
nächsten Fernsehausstrahlung im Programmheft angekündigt
werden wird. Fantasy oder Science Fiction? Es ist ganz oft
diskutierbar, aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
doch so, wie Clute und Nicholls sagen: Die meisten
Geschichten passen ziemlich eindeutig in den einen oder den
anderen Kernbereich. Und wenn Michael Dorn auf der FedCon
auftritt, so ist sein Worf ein SF-Charakter und wenn James
Marsters auftritt, so ist sein Spike ein Fantasycharakter.
Oder muss man Buffy wegen der Vampire zum Horror zählen?
Ach, lassen wir das besser und kommen wir zur eigentlichen
Geschichte der SF.
II, SF als Spiegel ihrer Zeit
Im Großen und Ganzen kann man
die Science Fiction problemlos als Prometheusgeschichten
klassifizieren. Und es ist kein Zufall, dass die Geschichte
der Science Fiction genau mit diesem Namen beginnt. Das
erste reinrassige Werk der SF ist nämlich Mary Shelleys
(1797-1851) Frankenstein, ein Buch mit dem
Untertitel Der moderne Prometheus. Warum gerade
Frankenstein?
Zuerst muss es ja so etwas wie Wissenschaft geben, um
Wissenschaftsfiktion verfassen zu können. Das Unmögliche
als Noch-Nicht-Mögliches, Darko Suvins Novum (Poetik
der SF, 93), ist die notwendige Bedingung für die
Existenz von SF; Wissenschaft als ihre Grundlage ist die
hinreichende Bedingung (95f.). Ein Weltbild, das noch
gänzlich nichtempirischem Denken verhaftet ist und das für
alle Natur- und Gesellschaftsphänomene übernatürliche
Erklärungen bemühen muss, wie es das mittelalterliche
Europa tat, bietet einfach nicht die geistige Grundlage für
die Entwicklung von Science Fiction. Das wissenschaftliche
Weltbild, so wie wir es heute verstehen, beginnt aber erst
mit der Entdeckung der empirischen wissenschaftlichen
Methodik in der Neuzeit ab dem 17. Jahrhundert.
Zweitens gehört zu SF, wie gerade ausgeführt, dass die
Geschehnisse zumindest theoretisch nicht ausgeschlossen
sind, was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass die SF
Erklärungen für die geschilderten imaginären Ereignisse
oder Techniken anbieten können muss. Aber auch das kann
erst gelingen, wenn ein entsprechender Theorieapparat
ausgebildet ist, von dem aus die Autoren und Regisseurinnen
dann ihre Extrapolationen entwickeln können, die zu
Zeitreisen oder der Entstehung künstlichen Lebens führen,
wie Shelley es in Frankenstein tut.
Außerdem ist es drittens wichtig, dass die imaginäre
Technik oder das imaginäre Ereignis einen zentralen Punkt
der Geschichte ausmacht. So gibt es Ende des 18.
Jahrhunderts eine ganze Reihe von Geschichten, die
imaginäre Ereignisse schildern, ohne gleich übernatürliche
Erklärungen dafür anzubieten. Retif de la Bretonne etwa
erzählt mit Der fliegende Mensch von einem Mann,
der sich einen Flugapparat baut und damit eine ganze Reihe
von Abenteuern erlebt. Dass dieser Flugapparat existiert,
erleichtert eine Reihe von Geschehnissen des Romans, die
man aber auch anders hätte lösen können. Eigentlich geht es
in dem Buch um gesellschaftskritische Themen, die mit dem
Flugapparat nichts zu tun haben. Außerdem ist das Ding so
armselig konstruiert, dass nicht einmal die theoretische
Möglichkeit bestand, dass es funktioniert hätte. Darauf kam
es dem Autor auch gar nicht an, sondern auf seine
Gesellschaftssatire.
Auf Frankenstein aber treffen die genannten Punkte
erstmals alle zu. Mary Shelleys Geschichte entsteht erstens
zu einer Zeit, als nicht nur die wissenschaftliche Methode
nach 200 Jahren Praxis vollkommen etabliert ist, sondern
als außerdem die Aufklärung ein rationalisiertes Weltbild
geschaffen hat, das schon weitgehend ohne Gott auskommt.
(Die erste schriftliche Äußerung, in der sich ein Mensch
zur eigenen atheistischen Überzeugung bekennt, erscheint 60
Jahre vor der Publikation von Frankenstein). Zweitens
erschafft der ‚Titelheld’ Viktor Frankenstein seine Kreatur
– die übrigens ganz anders als im Film nicht im Geringsten
monströs und außerdem hochkultiviert und intelligent ist –
mit rein wissenschaftlichen Methoden. Und dieses
Schöpfungsereignis ist drittens das zentrale Geschehnis der
Erzählung, von dem alles weitere ausgeht. Aus dieser völlig
entspiritualisierten Schöpfung entsteht die doppelte
Tragödie von Frankenstein. Einerseits geht es um das Thema
der Verantwortung des Wissenschaftlers, der Viktor
Frankenstein in keiner Weise gerecht wird. Andererseits
führt Shelley einen heftigen Schlag gegen die Aufklärung:
Frankensteins Kreatur zerbricht daran, dass sein Leben
keinen Sinn hat, denn kein Gott erschuf ihn, sondern nur
ein normaler Mensch, der nicht mehr wollte, als zu
beweisen, dass er es kann. Trotz einer Reihe stilistischer
Schwächen und einigen langatmigen Passagen ist das Buch
absolut brillant, wenn man daran denkt, dass ein Teenager
dieses Meisterwerk schrieb. Und es ist absolut stilbildend
für die Science Fiction, die seit Frankenstein
immer wieder über das Thema Verantwortung redet.
Und noch ein Punkt lässt sich exemplarisch an diesem ersten
echten Science Fiction-Werk zeigen: die Reflexionsfähigkeit
des Genres. Science Fiction ist immer ein Spiegel ihrer
Zeit; manchmal berstend vor emphatischem Optimismus,
manchmal von deprimierendem Pessimismus. Shelley greift in
Frankenstein die experimentierwütigen
Wissenschaftler ihrer Zeit auf, lässt das Experiment
erfolgreich sein und zeigt, wie die Folgen des
erfolgreichen Experiments immer katastrophaler werden. Ja,
sagt Shelley, Wissenschaft und Aufklärung sind erfolgreich
und schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Aber, so
mahnt sie dann immer eindringlicher, je weiter sich
Frankensteins Kreatur ins tragische Geschehen verstrickt,
Wissenschaft und Aufklärung haben sich keine Gedanken über
die Folgen ihrer Taten gemacht. Damit zeichnet sie exakt
nach, wie sich Wissenschaft und Aufklärung im 18.
Jahrhundert auf einen Siegeszug begeben haben, und nimmt
ebenso die romantische Kritik an der Aufklärung auf, die
sich in den 20 Jahren vor der Entstehung ihres Buches
formierte. Ein Roman, der sich der imaginären Überspitzung
bedient, um die reale Welt der Autorin zu kommentieren. Das
wird sich in der Geschichte der Science Fiction ebenfalls
vielfach wiederholen.

Andere Welten, andere
Spiele
Dabei geht es nicht immer um
Kritik. Man kann sogar sagen, dass ein Gutteil der Science
Fiction gänzlich unkritisch ist und stattdessen begeistert
über die Möglichkeiten naturwissenschaftlicher wie
sozialwissenschaftlicher und psychologischer Entdeckungen
spekuliert. Die kritischen Werke warnen dann vor den Folgen
eben dieser Entdeckungen.
Diese Zeitgebundenheit und die sich äußernde Zeitkritik
sind nun kein Alleinstellungsmerkmal von SF. Literatur und
Film weisen dies ganz im Gegenteil durchgängig auf, ob es
sich nun um realistische Geschichten handelt oder nicht.
Bemerkenswert ist vielmehr, dass die so unrealistische
Science Fiction mit ihren Raumschiffen und Genexperimenten
so besehen eben überhaupt nicht unrealistisch ist, sondern
eben auf ihre Weise die reale Welt kommentiert. Es gibt
keinen Grund, von Seiten der sogenannten realistischen
Literatur naserümpfend auf die Science Fiction
herabzusehen. Natürlich gibt es schlechte Science Fiction,
aber schlechte Bücher und Filme gibt es in allen anderen
Genres auch. Aber da, wo SF gut ist, braucht sie sich vor
keinem Literaturnobelpreisträger zu verstecken.
III, SF überschreitet Grenzen
Die Zeitgebundenheit der SF
lässt sich sehr schön an den vorherrschenden Strömungen des
Genres und der Entstehungsumstände seiner Werke aufzeigen.
Wobei ich zu bedenken bitte, dass das Folgende eine
Darstellung genereller Tendenzen ist. Es gibt immer wieder
Werke, und oft sind das sicher nicht schlechtesten, die aus
dem generellen Trend herausfallen. So kommt es natürlich
auch noch zu den Hoch-Zeiten der Technikskepsis in den
Siebziger Jahren zum Auftreten optimistischer Space
Frontier-Erzählungen.
Nach Mary Shelley kommt es zunächst zu wenigen Genrewerken,
in der Phantastik überwiegt noch für Jahrzehnte die Gothic
Novel. Aber Mitte des Neunzehnten Jahrhunderts tauch ein
berühmter Name auf, der viel öfter als Mary Shelley im
Zusammenhang mit SF genannt wird: Jules Verne (1828-1905).
Und Verne läutet nach der wissenschaftsskeptischen
Frankenstein-Autorin eine Zeit des Optimismus ein,
wenn auch nicht so kritiklos wie spätere
Technikenthusiasten.
Mit seinen Geschichten von Reisen zum Mond, zum Meeresgrund
und zum Mittelpunkt der Erde sowie einer ganzen Reihe
weiterer phantastischer Abenteuer, die aber auf
übernatürliche Ereignisse verzichten, ist Verne noch heute
ein weit außerhalb der Gemeinschaft der Genrefans bekannter
Name. Zu seiner Zeit war er einer der bekanntesten
Schriftsteller der Welt und kommerziell so erfolgreich wie
heute im Bereich SF höchstens der Regisseur James Cameron.
Verne schrieb zu einer Zeit als europaweit zwei Aufbrüche
stattfanden – der Siegeszug der Technik und endlich erste
politische Erfolge der Befreiung von der Herrschaft des
Adels und der zunehmenden Einflussnahme bürgerlicher
Bevölkerungskreise. Die Mehrheit der Bevölkerungen hatte
immer noch nichts zu sagen, aber die Mitspracherechte waren
schon viel breiter gestreut als noch 50 Jahre zuvor, als
Sturm und Drang politische Wogen ohne echte
Befreiungserfolge schlugen. Insbesondere die Mittelschicht
und die Intellektuellen, aus deren Kreisen sich in Europa
fast alle Schriftsteller rekrutierten, erlebten materiellen
Wohlstand, der meist in nahem oder fernerem Zusammenhang
mit der Industrialisierung und ihrer Technologien stand und
sie genossen die Freiheit ehedem ungewohnter politischer
Betätigungsmöglichkeiten. Für diese Menschen sah die Welt
gut aus, und lange nicht jeder Schriftsteller hatte, wie
Heinrich Heine etwa, mögliche Schattenseiten des
Fortschritts schon auf dem Schirm.
Kein Wunder also, dass die frühe Science Fiction eines
Jules Verne sich optimistisch mit den Möglichkeiten
befasste, die die Zukunft bringen würde. Also extrapolierte
Verne fleißig, was sich an technischen Möglichkeiten seiner
Tage bot und schickte Leute mit Projektilen zum Mond und
mit U-Booten unter Wasser. Vieles, was Verne schrieb, waren
typische Frontier-Stories, von Menschen, die mit Optimismus
und Erfindungskraft Grenzen überschritten und neue Räume
erschlossen. Das ist ein Thema, das die Science Fiction bei
aller Diversität des Genres wahrscheinlich stärker geprägt
hat als jedes andere.
Und es dürfte die Faszinationskraft des Genres am besten
erklären, denn die Spekulation zieht die Erfindungskraft
des Menschen gewaltig an. Da sich SF zudem innerhalb der
Naturgesetze bewegt, ist die Spekulation keine reine
Träumerei, denn vielleicht lässt sie sich ja verwirklichen.
Wir wissen zwar mit großer Sicherheit, dass wir es nicht
erleben werden, dass wir uns nach Feierabend auf
Südseeinseln beamen lassen können, aber – hey, wer weiß
schon, was nicht vielleicht doch gehen wird ...
Aber auch bei Verne findet sich schon die Sorge, dass
Technologie nicht die alleinige Lösung sein wird. Zu Vernes
Zeit dachte man zwar noch, dass Technik einmal alles können
wird, aber man ahnte auch, dass Alles vielleicht ein
bisschen zu viel für den Menschen ist. Vernes
charismatischste Figur Kapitän Nemo macht Erfindungen, die
die Welt in ein Paradies verwandeln könnten, aber er weiß
auch, wie leicht die Kräfte, die er anzuzapfen lernte,
missbraucht werden können und gibt sie nicht weiter.
Spannender als alle technische Spekulation ist meiner
Meinung nach, die Spekulation darüber, was wir merkwürdigen
Menschenwesen mit der Technik anstellen würden. Der nächste
große SF-Autor stellte denn auch den Menschen völlig in den
Vordergrund seiner Erzählungen.
IV, SF handelt vom Menschen
Wir befinden uns immer noch in
der bis zum Ersten Weltkrieg anhaltenden Phase eines nahezu
weltweiten Optimismus, als ein Autor die Bühne betritt,
dessen Themen schon gar nicht mehr optimistisch sind,
zumindest nicht in den besten Werken, und geschrieben hat
er unheimlich viel. Der Engländer H. G. Wells (1866-1946)
ist so etwas wie der Übervater der SF; es gibt praktisch
kein großes Thema, das Wells in seinen vielen Romanen und
Kurzgeschichten nicht behandelt hätte – das reicht von
Raum- und Zeitreisen über Robotergeschichten (auch wenn der
Roboter damals noch nicht Roboter hieß) über Genetik und
medizinische Experimente bis zu politischen Utopien und
Dystopien. Und er hat typischerweise die Nachteile immer
mitbedacht.

Aliens wie Sie und ich
...
Seine stärksten Werke schrieb Wells im ausgehenden
viktorianischen Zeitalter und vor Beginn des Ersten
Weltkriegs. Die Welt überdehnte damals und die entwickelten
Staaten rasten wie riesige Dampfloks in Feindschaft
aufeinander zu, man konnte ahnen, dass eine Zeitenwende
eintrat und Wells’ Werke nahmen die kommenden Verwerfungen
gedanklich vorweg. Nichtsdestotrotz führte er das Genre
jedoch erstmals auf die volle Höhe, die das Spekulieren zu
erreichen vermag: Er entwarf nachvollziehbare Entwicklungen
und berichtete relativ neutral davon, was dieses oder jenes
bedeuten würde. Er schrak weder entsetzt vor der Zukunft
zurück, noch stürzte er sich unkritisch in ihre Arme.
Überhaupt: die Zukunft. Von der ist natürlich zu sprechen,
wenn man die Science Fiction behandelt. Im deutschen
Sprachraum wurde SF ja sogar lange Zeit mit „Zukunftsroman“
gleichgesetzt. Allerdings hat die Zukunft zu Recht nichts
mit der Definition von SF zu tun, denn theoretische
Möglichkeiten lassen sich auch im Hier und Jetzt
beschreiben und man kann sie sogar in die Vergangenheit
versetzen oder lässt sie in alternativen Realitäten oder
einfach nur weit entfernt passieren. Das Extrem ist dann
Olaf Stapledons Meisterwerk Star Maker, das aus
allen Zeiten und Orten des Universums zugleich berichtet.
Da aber SF über Technik und Technologien spekuliert, spielt
sie naturgemäß meist in der Zukunft.
V, SF und Pioniergeist
Besonders beliebt war die
futuristische Spekulation in der nächsten wichtigen Station
der SF, in den amerikanischen Magazinen. Verbunden ist
diese Spielart der SF vor allem mit zwei Namen,
ausnahmsweise einmal keine Schriftsteller, sondern
Herausgeber: Hugo Gernsback (1884-1967) und John W.
Campbell (1910-1971). Beide verfassten zwar auch
Geschichten, die waren jedoch nicht so bemerkenswert. Umso
bemerkenswerter war beider Einfluss als Herausgeber von
SF-Magazinen; eine Publikationsform, die eine Unzahl
einflussreicher Genreerzählungen hervorbrachte, die riesige
us-amerikanische SF-Szene entscheidend prägte und vielen
Autoren eine Karriere als Schriftsteller ermöglichte. Man
kann die amerikanischen Science Fiction-Magazine von 1926
bis in die Fünfziger Jahre hinein mit Fug und Recht als
eigenes Sub-Genre der SF bezeichnen. Anders als im Falle
der oft überschaubaren Leserschaft der europäischen Autoren
dieser Zeit, waren die Magazine auch ein Publikumserfolg,
und im nachhinein werden die Jahre der Magazine auch als
das Goldene Zeitalter der Science Fiction bezeichnet. Der
Einfluss dieser Zeit und Szene wurde nur noch von den
Drehbuchautoren der SF-Serien ab den Sechziger Jahren
überboten.
Gernsback, nach dem einer der wichtigsten Literaturpreise
der Phantastik benannt ist, der HUGO, gründete 1926 mit
Amazing Stories das erste reinrassige SF-Magazin.
Gernsbacks Interesse galt in erster Linie der Vorhersage
technologischer Errungenschaften. Der Titel eines weiteren
seiner Magazine steckte das Programm ab, für das Gernsback
stand: Science Wonder Stories. Halbwegs
begründbare Ausblicke auf die kommenden Triumphe der
Menschheit, die in erster Linie auf Ingenieurskunst
beruhten bildeten die Basis seiner Magazine, und auch das
Gros der in den Zwanziger bis Vierziger Jahren
erscheinenden us-amerikanischen SF-Geschichten; ein
grundsätzlicher Optimismus und die Hoffnung auf eine
glorreiche Entwicklung kennzeichneten den Grundtenor.
Dies war auch in John Campbells Astounding so,
wenn auch schon mit größerer Differenziertheit. Gernsbacks
Amazing Stories hatte die Magazin-SF eröffnet und
einen inhaltlichen Rahmen abgesteckt, Campbells
Astounding führte Qualität und Originalität in das
Sub-Genre ein, denn dieser Herausgeber legte literarische
Maßstäbe an seine Autoren, denen man als Schreiber erst
einmal genügen musste. Und er ermutigte Autoren anderer
Genres sowie junge Männer, die vielleicht gar nicht daran
gedacht hatten SF zu schreiben, zu Autorschaften. Auf diese
Weise entdeckte Campbell praktisch die gesamte Elite
amerikanischer SF-Autoren im Alleingang: Robert A.
Heinlein, A. E. van Vogt, Theodore Sturgeon und viele
andere bis hin zum unvergesslichen Isaac Asimov.

Erstkontakt, selbst
mit Alien geht das freundlich ...
Junge Männer? Wieso nur junge
Männer? Weil es praktisch nur weiße, mehr oder weniger
junge Männer waren, die für die Magazine schrieben; die
meisten zudem mit einer technischen oder
naturwissenschaftlichen Ausbildung im Hintergrund. Frauen
und Mitglieder anderer Ethnien kamen in der amerikanischen
Science Fiction bis in die Fünfziger Jahre kaum vor. Einen
sehr schönen kleinen Einblick in diese Szene gibt übrigens
die vielleicht beste SF-Folge der Fernsehgeschichte Far
Beyond the Stars aus der sechsten Staffel von Star
Trek Deep Space Nine. Hier träumt Captain Benjamin
Sisko, dass er ein schwarzer Magazinautor auf der Erde
Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts sei, und es stellt sich
die letztlich unbeantwortete Frage, ob nicht das gesamte
Star Trek-Universum von ein paar halbverrückten
Schriftstellern in weit zurückliegender Vergangenheit
erdacht wurde. Ein unglaublich ausgeklügeltes,
selbstironisches Spiel mit den Realitäten, eingebettet in
eine 45-minütige Fernsehfolge. Nebenbei beschreibt die
Folge aber auch, wie unannehmbar es für die Genrefans
damals war, dass Frauen oder Nichtweiße an den geliebten
SF-Magazinen mitarbeiteten.
Insgesamt gesehen war die Zeit der amerikanischen Magazine
eine Zeit der technophilen, optimistischen
Zukunftsausblicke, trotz oder gerade weil sich meist auch
dichter Schlachtenrauch über die Geschichten legte. Obwohl,
dieser Vergleich hinkt, denn Strahlenwaffen erzeugen wenig
Rauch – Schlachten aber waren ein beliebtes Sujet,
besonders in den ebenfalls erstmals in dieser Zeit
erzählten Space Operas, man denke nur an E. E. „Doc“ Smith
und seine legendären Lensmen. Dabei kam es aber auch zu
Geschichten, die nicht unbedenklich waren, erzählte Smith
doch beispielsweise auch mit relativ leichter Hand von
lebensunwürdigen Geschöpfen, die denn auch bedenkenlos
niedergemacht werden. Robert Heinlein erschuf eine zutiefst
autoritäre Weltordnung, in der Bürgerrechte nur die
Soldaten haben (Starship Troopers). Und Hans
Dominik bewegte sich in gefährlicher gedanklicher Nähe zu
den Nazis, wahrscheinlich absichtlich, war er doch auch
dadurch der kommerziell bei weitem erfolgreichste deutsche
SF-Schriftsteller zwischen den Kriegen und im Dritten
Reich.
VI, Geschichten von der
Zukunft erklären Vergangenes
Die europäische Science Fiction
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg stellte jedoch eher
einen Gegenentwurf zum optimistischen amerikanischen
SF-Genre dar und war auch in dieser Hinsicht Spiegel ihrer
Zeit. Amerika war trotz Teilnahme am Weltkrieg von ihm
relativ unberührt geblieben, während in Europa ganze
Landstriche verwüstet waren, die meisten Familien Opfer zu
beklagen hatten und so gut wie alle männlichen
Schriftsteller den Krieg mitgemacht hatten. Einen Krieg der
erschreckend anders war. Vorige Kriege waren von kurzen,
heftigen Schlachten bestimmt, nachfolgende Kriege sind
aufgrund der Technologie – Raketen, Jets,
Kampfhubschrauber, Computer – durch ständig neue
Situationen charakterisiert. Im Ersten Weltkrieg aber lagen
sich die Soldaten jahrelang in schlammigen Gräben gegenüber
und starben stückweise, weniger an Waffeneinwirkung als an
Krankheit und Verzweiflung. Das schlägt sich in der
Europäischen Nachkriegsliteratur nieder, etwa T. S. Elitos
Waste Land oder Erich Maria Remarques Im
Westen nichts Neues. Und auch die Phantastik war nicht
unbetroffen – die lebensfeindliche Ödnis Mordor in Tolkiens
Der Herr der Ringe hatte der Autor in
französischen Schützengräben selbst kennengelernt.
Damit aber nicht genug, fanden in Europa Umwälzungen statt,
die mit den USA in keiner Weise vergleichbar waren.
Deutschland war ein unglückliches Land, das 15 Jahre mit
sich selbst haderte und sich dann das größtmögliche Übel
wählte. England verlor langsam aber sicher seine Kolonien
und damit sein Selbstverständnis und in Sowjet-Russland
begann ein grausames gesellschaftspolitisches Experiment
ohne Gewinner. Und wieder zeigt sich die Zeitabhängigkeit
und Kommentarfunktion der Science Fiction, denn europäische
Autoren erfinden die ersten großen technisch und
sozialtechnologisch bedingten Utopien der SF. Von denen die
meisten allerdings Dystopien sind.
Der erste große Wurf gelingt Jewgeni Samjatin schon drei
Jahre nach der Oktoberrevolution mit seiner bissigen
Abrechnung mit totalitären politischen Regimen, dem Roman
Wir, der Vision einer vollständig unterdrückten
Gesellschaft, die eng an die sich abzeichnende Entwicklung
der Sowjetunion angelehnt ist. Die meisten sowjetischen
Autoren der Zwischenkriegszeit schrieben allerdings auf
Linie, was schade ist, denn Russland, das Land vieler
berühmter phantastischer Autoren und Regisseure, verfügt
über eine großartige Science Fiction-Tradition, zu der
parteilich bestellte Jubelhymnen allerdings wenig
beitragen. Noch berühmter als Wir wurde Aldous
Huxleys Dystopie Schöne neue Welt. In ihr wird die
Welt von Sozialtechnologen so umgestaltet, dass die
Menschen mittels Drogen und anderen medizinischen
Eingriffen jeglicher Freiheit beraubt werden und dabei auch
noch glücklich sind. Interessant sind hier nicht die
eingesetzten Techniken, sondern das, was sie auf
psychischer und gesellschaftlicher Ebene bewirken.
Wir und Brave New World sind großartige
SF auch weil sie von der bloßen Technik absehen und eine
technisch wirkende Gesellschaftsplanung in den Mittelpunkt
stellen, die zeigt, dass auch Sozialtechnologien Werkzeuge
sind, die mit kaum absehbaren Folgen eingesetzt werden
können. Dass dies nicht immer negativ daherkommen muss,
zeigt dann Isaac Asimov mit seinem Foundation-Zyklus, in
der eine solche Sozialtechnologie, die Psychohistorik, die
letzte Hoffnung für die Menschheit darstellt. Weitere
Höhepunkte finden derartige gesellschaftliche Spekulationen
dann in zwei späteren SF-Meisterwerken, 1984 von
George Orwell und Planet der Habenichtse von
Ursula K. Le Guin.
VII, Sorgen und Philosophie
Doch zurück zur
Zwischenkriegszeit und einem absolut für sich stehenden
SF-Autor, dessen Einfluss nur noch von H. G. Wells
übertroffen wird: Olaf Stapledon (1886-1950). Stapledon ist
ein englischer Philosoph – Kriegsteilnehmer wie Tolkien,
Eliot, Remarque – der eine Menschheits- und eine universale
Geschichte schrieb, die voller phantastischer Motive sind,
die von unzähligen Autoren und Regisseuren aufgenommen
wurden. Das eigentlich Besondere an Last and First
Men und Star Maker ist jedoch der
tiefgründige Optimismus der Werke. Last and First
Men erzählt die Geschichte der Menschheit ab dem 20.
Jahrhundert bis in eine Milliarden von Jahren entfernte
Zukunft, Star Maker erzählt die Geschichte des Universums
von Anfang bis Ende. Beide Bücher enthalten keine
eigentliche Handlung, sondern sind wie echte
Geschichtsbücher aufgebaut. Und die Geschichte der Menschen
wie die des Universums sind von aufeinanderfolgenden
Tragödien gekennzeichnet, die die echte erlebte Tragödie
des Autors, den Ersten Weltkrieg, klein erscheinen lassen.
Das Ende beider Geschichten ist jedoch ein hoffnungsvolles,
erlösendes, denn Menschheit und Universum enden in
Perfektion und Erleuchtung, ein hegelianisches Ende der
Aufgeklärtheit und des ewigen Friedens. Allerdings konnte
der Autor auch anders, und zeigt beispielsweise in
Sirius: a Fantasy of Love and Discord eher
pessimistische Überzeugungen. Stapledon ist jednefalls der
größte Visionär eines Genres, das von Visionen lebt.
Dann kam es zum Zweiten Weltkrieg und darin zu zwei
Ereignissen, die die Science Fiction bis heute
beschäftigen: der Massenmord in den Konzentrationslagern
und der Abwurf der Atombomben. Der versuchte umfassende
Genozid der Nazis warf ein Licht darauf, zu welch vorher
unvorstellbarem Bösen Menschen fähig sind und die Atomkraft
rief nach einer kurzen Phase der euphorischen Spekulationen
vor allem Zweifel und Ängste über die
Verantwortungsfähigkeit des Menschen hervor: Die Zukunft in
der SF wurde immer dystopischer.
Auch wenn sich ganz bemerkenswerte Werke unter der
kritischen SF befinden, reicht es im Rahmen dieses
Vortrages, darauf hinzuweisen, dass die generelle
Genreentwicklung in Richtung Kritik und Pessimismus ging,
und dass sich optimistische Ausblicke und hoffnungsvolle
SF-Abenteuer eigentlich erst seit den Neunziger Jahren
wieder auf dem Vormarsch befinden. Mit einer großen
Ausnahme allerdings: Gene Roddenberry (1921-1991), der
Schöpfer von Star Trek, der das Wesen des
Humanismus in 50 Minuten zu erklären verstand.
Ich glaube, dass ich käfigweise Eulen nach Athen trüge,
wenn ich hier auf der FedCon über die Geschichte von
Star Trek spräche, weshalb ich uns das einfach
erspare. Was die Serien jedoch so bemerkenswert macht,
möchte ich hervorheben, weil es für die Geschichte der SF
so wichtig ist: das sind der unglaublich optimistische
Duktus, auf dem Roddenberry bestand, und die
außerordentliche Tiefe eines oberflächlich rein
unterhaltend aussehenden Medienereignisses. In Star
Trek können Probleme und Verständigungsschwierigkeiten
selbst kosmische Ausmaße annehmen, sie lassen sich so gut
wie immer vernünftig lösen. (Ganz bemerkenswert ist
übrigens, dass die einzige Folge in der Originalserie, die
eine rein gewalttätige Lösung als ultima ratio präsentiert,
die Folge ist, in der die Crew um Kirk es mit einem
Nazi-Planeten zu tun hat – Patterns of Force). Die
inhärente Friedfertigkeit der Föderation lässt zwar in den
späteren Serien teilweise stark nach, verliert sich aber
nie völlig, so dass Roddenberrys Vorgaben sich im Prinzip
erhalten haben.
Ebenso bemerkenswert an Star Trek ist die Qualität
der Drehbücher, die eigentlich immer hochintelligent
unterhalten, teilweise aber sogar Sternstunden der
phantastischen philosophischen Spekulation darstellen. So
beispielsweise die immer wiederkehrenden Themen der
Welt hinter den Spiegeln oder die Geschichten um
den allmächtigen Q, und wie leicht Allmacht zu Ohnmacht
wird. Erwähnt hatte ich schon die großartige Behandlung des
Realitätenproblems in Far Beyond the Stars aus
Deep Space Nine. Noch berühmter ist wohl die
TNG-Folge Darmok, in der es um die Kommunikation
zwischen Lebewesen mit völlig unterschiedlicher Denkensart
geht. Diese Folge wird übrigens vielfach von Linguisten in
der universitären Lehre als Anschauungsbeispiel eingesetzt.

Far beyond the
Stars
Die Liste ließe sich mit
Leichtigkeit verlängern, so dass man das Star
Trek-Universum bedenkenlos als eines der schönsten
Beispiele für einen Science Fiction-Kosmos loben kann. Und
von denen gibt es ja eine ganze Menge, die bis hin zu einem
Phänomen von mehreren tausend Büchern und Geschichten wie
den Perry Rhodan-Erzählungen reichen. Oder zur
längsten Sendereihe der Fernsehgeschichte, der seit über
vierzig Jahren laufenden Serie Doctor Who. Serien,
oft mit zahlreichen Spin offs verbunden, sind
offensichtlich ganz typisch für die Phantastik und zeigen,
dass sie in vielen Fällen eine treue Fangemeinde um sich zu
scharen weiß.
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Science Fiction neben dem
Fernsehen sind die SF-Filme. Da es in diesem kurzen
Überblick in erster Linie aber um die Inhalte von SF geht,
so ist es nicht unbedingt nötig, den Filmen den gleichen
Raum wie den Büchern einzuräumen. Denn die Filme folgen in
der Regel den gleichen Strömungen, die auch die
Genreliteratur bestimmen. Dazu kommt, dass die berühmtesten
SF-Filme meist nicht auf Originaldrehbüchern beruhen,
sondern Verfilmungen von Büchern sind. 2001: A Space
Odyssey, zum Beispiel, das auf dem gleichnamigen Buch
von Arthur C. Clarke beruht. Oder als bestes Beispiel für
eine kritische Sozialutopie Clockwork Orange nach
der Vorlage von Anthony Burgess. Unbestreitbar ist, dass
Stanley Kubrick, wohl nicht zufällig der geniale Regisseur
beider Filme, in den Geschichten eigene Akzente setzt, aber
die generelle Idee blieb die gleiche. So ist es im Falle
von Verfilmungen auch oft ein ästhetischer Unterschied, der
das eigentlich innovative an der Behandlung des Stoffes
ausmacht, ohne dass es in nennenswerter Weise inhaltlich
zum Genre beiträgt. Ich denke da etwa an die Eingangsszene
aus 2001, die schlicht überwältigt, aber doch nur
der Verdeutlichung von Clarkes Gedanken dient, ohne sie zu
erweitern. Und auch wenn der erfolgreichste Film aller
Zeiten nun ein SF-Film ist, so wage ich doch zu bezweifeln,
dass die Pocahontas-Neuerzählung Avatar einen
bleibenden Eindruck als Science Fiction hinterlässt.
Dies ist keineswegs als Herabsetzung des Mediums Film
gedacht – oder des Comics und der Computerspiele, die ich
noch gar nicht erwähnt habe. Aber die Prometheus-Papiere
konzentrieren sich auf die Darstellung der
Entwicklungslinien von SF, und die zeichnen sich in den
Büchern und Magazinen am deutlichsten ab. Eine Geschichte
des SF-Films ist ja schon längst geschrieben und eine der
entsprechenden Comics und Spiele wird es sicher auch geben,
aber nicht an dieser Stelle von mir.
Es ist schwierig genug, jetzt schon einen Abschluss zu
finden. Wir befinden uns seit den Neunziger Jahren auf
einer Entwicklungsstufe, die Hoffnung und Skepsis, Kritik
und technologische Emphase beiderseits berücksichtigt.
Weiterhin kommentiert SF auf ihre Weise die Zeitläufte und
findet Gutes und Schlechtes dabei.
Seit den Achtzigern ist der Cyberpunk dazu gekommen, der
die Rolle der Vernetzung, die wir gerade jetzt am eigenen
Leib und ganz real zu spüren bekommen schon beeindruckend
vorweg nahm. Stichwort ist hier natürlich William Gibson,
aber auch Neil Stephenson sowie eine Reihe von
eigenständigen Filmen, nicht zuletzt die Matrix-Trilogie
(in qualitativer Hinsicht natürlich nur Teil 1, und der ist
von Fassbinders Welt am Draht geklaut). Gleiches gilt für
die Aufmerksamkeit, die das Genre den biologischen und
medizinischen Entdeckungen widmet und im Transhumanismus
beispielsweise von Peter F. Hamilton zum Ausdruck bringt.
Wieder geht es in beiden Hinsichten um Ausblicke, diesmal
vor allem um Ausblicke, die sich ganz dem Menschsein
widmen. Denn das Menschsein an sich wird durch die
Vernetzung zu überindividuellen Organismen oder durch die
Modifikation des Menschen durch genetische Eingriffe
infrage gestellt. Und anders als die jeweiligen Extremisten
in der realen politischen Diskussion diskutieren die
SF-Autoren und Regisseure das Thema erfreulich offen und
stellen mögliche Vor- wie Nachteile einander gegenüber.
Andere wichtige Themen sind damit noch gar nicht genannt,
etwa die Geschichten, die sich um die Auswirkung von
Künstlichen Intelligenzen drehen und und und ...

Phantastische Zukünfte
Sicher ist nur, es bleibt
spannend. Und sicher ist auch, dass SF eine wichtige
künstlerische und intellektuelle Reflexionsform ist. Die
Vordenker der Science Fiction mögen sich in Detailfragen
geirrt haben. Verne lag mit der Antriebsart daneben, aber
nicht mit dem Ergebnis, dass der Mensch den Mond betreten
würde. Und so wird die SF auch in Zukunft in Details weiter
raten müssen, aber in den grundsätzlichen Fragen kann sie
mit Beispielen wie in 1984 oder Brave New World die Folgen
des (sozial-)technologischen Handelns oder Unterlassens
besser illustrieren als jeder Vortrag.
Und dass sie ganz glänzend unterhält, ist Vergnügen und
Stärke, denn so spricht sie viel mehr Menschen an!
Hier sitz’ ich, forme
Menschen nach meinem Bilde,
ein Geschlecht, das mir gleich sey, zu leiden, zu weinen,
zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten,
wie ich!
(J. W. v. Goethe, Prometheus)
Literatur:
Aldiss, Brian/ Wingrove, David: Trillion Year Spree. The
History of Science Fiction. London u. a.: Paladin 1988.
Alpers, Hans-Joachim/ Fuchs, Werner/ Hahn, Ronald M./
Jeschke, Wolfgang: Lexikon der Science fiction Literatur. 2
Bände. München: Heyne 1980.
Bailey, James Osler: Pilgrims Through Space and Time.
Westport: Greenwood Publishers. First Reprinting 1972.
Clute, John/ Nicholls, Peter: The Encyclopedia of Science
Fiction. London: Orbit 1993.
Platon: Sämtliche Dialoge. Hrsg. v. O. Apelt. Hamburg:
Meiner 1993.
Stürzer, Anja: Frankenstein. Mary Shelley (1797-1851)
erschuf das berühmte Monster. In: Ch. Kerner (Hrsg.): Die
fantastischen 6. Weinheim, Basel: Beltz & Gelberg 2010.
228-273.
Suvin, Darko: Poetik der Science Fiction. Zur Theorie und
Geschichte einer literarischen Gattung. Frankfurt/M.:
Suhrkamp 1979.